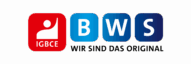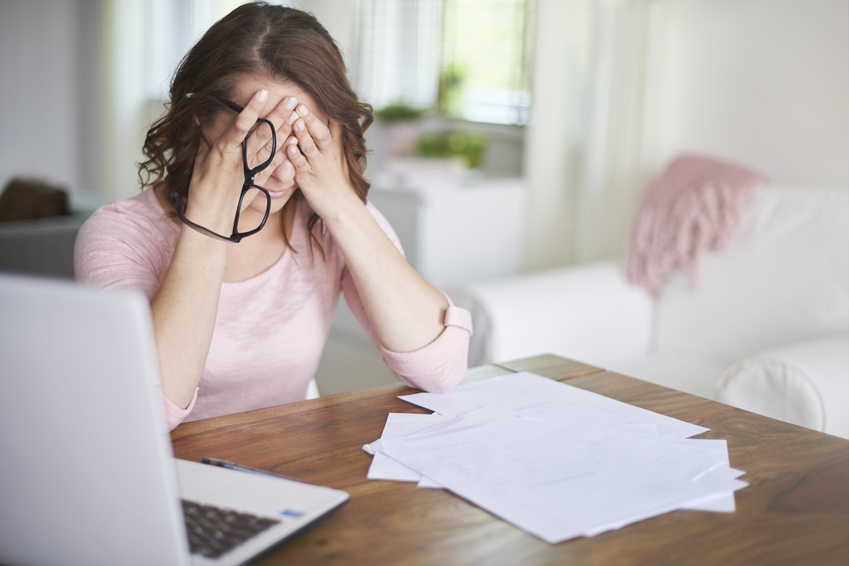Das war der Fall
Die Beteiligten sind die Arbeitgeberin, der elfköpfige Betriebsrat und vier im Betrieb wahlberechtigte Arbeitnehmer. 71 Wahlberechtigte verlangten die Aushändigung von Briefwahlunterlagen, wobei 23 ihr Verlangen ohne ordnungsgemäße Begründung in einer E-Mail an den Wahlvorstand richteten. Der Wahlvorstand sandte ohne vorherigen Beschluss die Wahlunterlagen zu, wobei sie einem Mitarbeiter nicht übersandt werden konnten. Der Wahlvorstand teilte mit, dieser Mitarbeiter sie nicht ansprechbar in einer Klinik. Die Briefwahlunterlagen enthielten ein Merkblatt mit dem Hinweis darauf, dass der Stimmzettel mit der Schrift nach innen zu falten sei, sodass die Stimmabgabe erst beim Öffnen des Zettels sichtbar wird. Auf dem Stimmzettel selbst stand »Stimmzettel bitte mit dem Schriftbild nach innen falten!«.
Bei der Stimmauszählung wurden vier Stimmen für ungültig erklärt, da sie mit der Schrift nach außen gefaltet waren. Die vier Wahlberechtigten fechten die Wahl an. Die Ungültigerklärung greife in unzulässiger Weise in ihr Wahlrecht ein. Die Hinweise auf das Falten der Stimmzettel seien unzureichend gewesen, da sie wie eine Bitte ausgedrückt wurden. Zudem sei nicht genügend unternommen worden, um dem Arbeitnehmer, dem die Wahlunterlagen nicht übermittelt werden konnten, diese zukommen zu lassen.
Die vier Arbeitnehmer hatten ursprünglich beantragt, dass die Wahl für ungültig erklärt wird. Das Arbeitsgericht hatte den Antrag abgewiesen, das Landesarbeitsgericht hatte ihm stattgegeben. Der Betriebsrat begehrt in seiner Rechtsbeschwerde die Wiederherstellung der erstinstanzlichen Entscheidung.
Das sagt das Gericht
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass die Rechtsbeschwerde des Betriebsrats begründet sei. Die Betriebsratswahl sei nicht anfechtbar.
Voraussetzung für die Anfechtbarkeit der Wahl sei gem. § 19 Abs. 1 und 2 BetrVG, dass gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen wurde und keine Berichtigung erfolgt sei. Zudem müsse durch den Verstoß das Wahlergebnis geändert oder beeinflusst worden sein.
Dies sei vorliegend nicht der Fall. Die Übermittlung der Wahlunterlagen mittels E-Mail verstoße, entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgericht, nicht aufgrund fehlender Begründung gegen § 24 Abs. 1 S. 1 WO. Die Pflicht zur Übermittlung der Briefwahlunterlagen setze keine ausdrückliche Begründung und auch keine Beschlussfassung des Wahlvorstandes über die Übermittlung voraus. Dies ergebe sich aus dem Wortlaut, welcher von »Verlangen« und nicht von »Antrag« spreche. Bei letzterem wäre ein Begründungserfordernis naheliegender. »Verlangen« weiße eher darauf hin, dass nur geäußert werden muss, dass die Wahlunterlagen übermittelt werden sollen. Zudem beziehe sich der Satzteil „… die im Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom Betrieb verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben…« auf die Wahlberechtigten und nicht auf das Nomen »Verlangen«, sodass auch die Grammatik gegen ein Begründungserfordernis spreche.
Dies entspreche auch der systematischen Stellung der Vorschrift. Ein Vergleich mit anderen Bestimmungen der Wahlordnung ergebe kein Begründungserfordernis. Früher sei die Erteilung des Wahlscheins an die Voraussetzung der Glaubhaftmachung geknüpft worden. Eine vergleichbare Anforderung enthalte § 24 Abs. 1 S. 1 WO nicht, er sehe keine Form vor. Hätte der Gesetzgeber ein Begründungserfordernis vorgesehen, hätte es sich aus Dokumentationsgründen und der Rechtssicherheit angeboten, eine Text- oder Schriftform vorzusehen.
Auch § 24 Abs. 2 und 3 WO zeige, dass es keines Begründungserfordernisses bedürfe, da hier die Initiative zur Übermittlung der Unterlagen vom Wahlvorstand ausgehe. Zudem gebe die Wahlordnung dem Berechtigten keine Information über die Begründungspflicht, insb. sei eine solche nicht in den zwingenden Angaben eines Wahlausschreibens in § 3 Abs. 2 WO vorgesehen. Die Wahlordnung sehe weiter zwar die Aushändigung eines Merkblattes über die Art und Weise der Stimmabgabe vor, nicht jedoch über die Art und Weise, wie man die Briefwahlunterlagen erhalten könne. Für die Erklärung, dass der Stimmzettel vom Wahlberechtigten persönlich gezeichnet wurde, sei ein Vordruck vorgesehen, für die Erklärung, dass der Berechtigte im Zeitpunkt der Wahl an der persönlichen Stimmabgabe gehindert sei, hingegen nicht.
Der Zweck der Vorschrift spreche ebenfalls gegen ein Begründungserfordernis. § 24 WO solle eine umfassende Wahlbeteiligung sichern und diene somit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl. Gäbe es ein Begründungserfordernis, wäre unklar, ob bereits der Hinweis ausreiche, dass man nicht persönlich an der Wahl teilnehmen könne oder ob der Grund konkret benannt werden müsse. Dies bürge kaum handhabbare Risiken für die Rechtssicherheit der Wahl. Es hinge von zufällig gewählten Formulierungen ab, ob die Begründung ausreiche. Deshalb dürfe vom Wahlvorstand grundsätzlich unterstellt werden, dass bei Verlangen der Briefwahlunterlagen Wahlberechtigte im Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit im Betrieb daran gehindert seien, ihre Stimmen persönlich abzugeben.
Da keine Begründungspflicht bestehe, sei kein Beschluss des Wahlvorstandes darüber erforderlich, ob die Begründung für die Übermittlung der Briefwahlunterlagen ausreichend sei. Die Übermittlung stehe demnach nicht im Ermessen des Wahlvorstandes. Auch sei eine Beschlussfassung ausdrücklich lediglich im Fall des § 24 Abs. 3 WO vorgesehen.
Auch teleologische Gesichtspunkte gebieten laut BAG lediglich eine Prüfpflicht des Wahlvorstandes, wenn aufgrund objektiver Anhaltspunkte Zweifel daran bestehen, dass der Wahlberechtigte die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 WO erfülle. Der Wahlvorstand habe dann den Berechtigten zu einer entsprechenden Erklärung aufzufordern und ihn im Einzelfall zu einer Begründung anzuhalten.
Ebenfalls seien die nach außen gefalteten Stimmzettel keinen Anfechtungsgrund. Das Landgericht habe zutreffend festgestellt, dass die vier Stimmzettel wahlrechtskonform gem. § 25 S. 1 Nr. 1 WO für ungültig erklärt worden seien. Die Vorgabe, dass der Zettel nach innen zu falten sei, diene der Wahrung der Geheimheit der Wahl. Nach § 26 Abs. 1 S. 1 WO seien zu Beginn der Stimmauszählung die Wahlumschläge der schriftlich abgegebenen Stimmen zu öffnen und in die Wahlurne zu legen. Dies trage dem Umstand Rechnung, dass die persönlich abgegebenen Stimmen nicht in Umschlägen eingereicht werden und die schriftlichen und persönlich abgegebenen Stimmen nicht einer Wählergruppe zugeordnet werden können sollen. Zudem sei durch das falsche Falten der Zettel die Gleichheit der Wahl beeinträchtigt, wonach das aktive und passive Wahlrecht von jedem formal möglichst gleich ausgeübt können werden solle. Ein Beschluss über die Ungültigkeit der Zettel sei nicht erforderlich, da dessen Fehlen sich nicht auf das Wahlergebnis i.S.d. § 19 Abs. 1 BetrVG auswirke.
Bei der Stimmzählung seien einzeln die Freiumschläge geöffnet worden und dann mittels der Erklärung über die persönliche Stimmabgabe und der Wählerliste geprüft worden, ob bereits eine persönliche Stimmabgabe erfolgt sei. Dann wurde der jeweilige Wahlumschlag geöffnet und die falsch gefalteten wurden nicht in die Wahlurne gelegt. Es sei kein Anfechtungsgrund nach § 26 WO dadurch gegeben, dass die Stimmzettel nicht erst alle in die Wahlurne gelegt wurden und die falsch gefalteten anschließend aussortiert wurden. Dem stehe nicht entgegen, dass bei der ersten Vorgehensweise eine persönliche Zuordnung der Stimme möglich und so nicht die Geheimheit der Wahl gewahrt sei. § 26 WO sehe weder die Pflicht noch ein Verbot dafür vor, die falsch gefalteten Zettel zuerst in die Wahlurne einzulegen. Der Wortlaut des § 26 Abs. 1 S. 2 WO sehe zwar vor, dass der Wahlumschlag erst bei ordnungsgemäß erfolgter Stimmabgabe i.S.d. § 25 WO geöffnet werde, jedoch sei die richtige Faltung, die § 25 WO verlangt, denklogisch erst wahrnehmbar, wenn der Wahlumschlag geöffnet sei. Demnach sei das Nichteinlegen der Zettel nicht unzulässig. Der Verweis des § 26 WO auf § 25 WO zeige, dass die Wahlumschläge nicht erst dann zu öffnen seien, wenn die Zuordnung zum Freiumschlag nicht mehr möglich sei, dies würde u.a. zu einem unlösbaren Konflikt führen, wenn es nur einen Briefwähler gebe.
§ 14 Abs. 1 S. 2 WO, welcher die Prüfung der Gültigkeit der Stimmzettel auf den Zeitpunkt der Öffnung der Wahlurne festsetze, stehe nicht entgegen.
Die Vorgaben der §§ 25, 26 WO seien durch § 126 Nr. 5 und 6 BetrVG mit einer tauglichen Ermächtigungsgrundlage gedeckt. § 11 Abs. 3 WO und §§ 25, 26 WO würden das Wahlrecht aus § 7 BetrVG nicht in unzulässiger Weise einschränken. Die Vorgabe, wie der Zettel zu falten sei, stelle keine unzumutbare Anforderung an den Wähler.
Der Wegfall der Wahlumschläge bei der persönlichen Stimmabgabe und die darauffolgende Faltvorgabe gestalten den Grundsatz der geheimen Wahl gerade aus und widersprechen diesem nicht. Zwar könne man, wie oben ausgeführt, erkennen, dass ein Briefwähler eine ungültige Stimme abgegeben habe, sollte man damit aber eine Einschränkung des Wahlgeheimnisses verbinden, sei dies durch die Allgemeinheit der Wahl gerechtfertigt.
Es bestehe auch kein Verstoß gegen § 24 Abs. 3 WO, der die Aushändigung eines Merkblattes über die Art und Weise der schriftlichen Stimmabgabe verlange. Es handele sich zwar um eine Soll-Vorschrift, sodass unklar sei, ob die Nichteinhaltung gegen eine wesentliche Vorschrift des Wahlverfahrens i.S.d. § 19 Abs. 1 BetrVG verstoße. Jedenfalls aber dürfe ein Merkblatt, wenn es ausgehändigt wird, keine fehlerhaften oder widersprüchlichen Informationen enthalten. Das BAG führt aus, das LAG habe zutreffend festgestellt, dass der Hinweis zur Faltung auf dem Stimmzettel selbst und der Hinweis auf dem Merkzettel inhaltlich übereinstimmen. Dem stehe die Verwendung der Höflichkeitsform „Bitte“ nicht entgegen.
Auch darin, dass einen Arbeitnehmer die Wahlunterlagen nicht erreicht haben, sei kein Anfechtungsgrund zu sehen.
© bund-verlag.de (kbe)
Mehr Infos zum Thema ungültige Stimmzettel bei der Betriebsratswahl findest du hier.