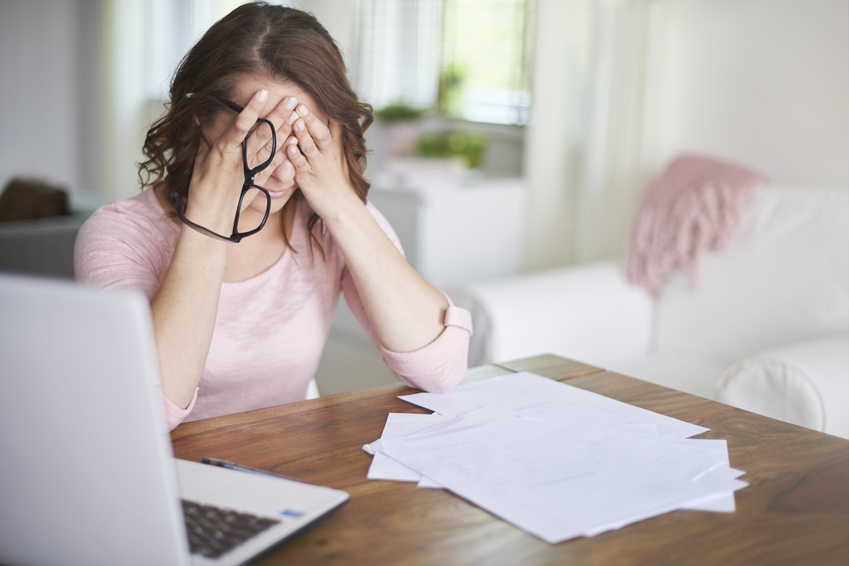Das war der Fall
Im zugrunde liegenden Fall hatte der Arbeitgeber im Rahmen einer Restrukturierung wesentliche Betriebsteile geschlossen. 38 Beschäftigte hatten dem Betriebsübergang widersprochen und waren in der Folge in einem Restbetrieb weiterbeschäftigt worden.
Auch der Kläger war in diesem Restbetrieb beschäftigt und wandte sich gegen seine Kündigung, die zu einem Zeitpunkt erfolgte, als nur noch fünf Mitarbeitende im Restbetrieb waren. Er hat deren Unwirksamkeit wegen fehlender sozialer Rechtfertigung und nicht ordnungsgemäßer Betriebsratsanhörung geltend gemacht.
Der Kläger hat vor dem Arbeitsgericht die Auffassung vertreten, das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) sei anwendbar. Wegen des von ihm erklärten Widerspruchs gegen den Betriebsübergang sei er im Restbetrieb verblieben, dem zum 1. Juli 2023 mehr als zehn Arbeitnehmende angehört hätten.
Der Arbeitgeber könne sich nicht darauf berufen, dass zum Kündigungszeitpunkt lediglich fünf Mitarbeitende bei der Feststellung der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmenden zu berücksichtigen seien. Aus dem Umstand, dass die Kündigung erst sieben Monate nach dem Verbleib im Restbetrieb erfolgt sei, ergebe sich, dass offensichtlich abgewartet wurde, bis nur noch wenige Mitarbeitende verblieben waren, um dann außerhalb der Vorgaben des KSchG zu agieren.
Das sagt das Gericht
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg stellte klar, dass für die Beurteilung der Betriebsgröße nicht allein die Anzahl der Beschäftigten zum Zeitpunkt des Kündigungszugangs maßgeblich ist, sondern vielmehr die Zahl der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer im Zeitpunkt der unternehmerischen Entscheidung, die zur Kündigung führte.
Das LAG betonte zudem, dass die Darlegungs- und Beweislast für die Unterschreitung der Schwelle aus § 23 Abs.1 KSchG beim Arbeitgeber liegt.
Entgegen der Auffassung des Arbeitsgerichts ist der Restbetrieb kein Kleinbetrieb, der aus dem Anwendungsbereich des KSchG herausfiele. Der Beschäftigungsbetrieb des Klägers weist die nach § 23 Absatz 1 Satz 3 KSchG erforderliche Mindestbeschäftigtenanzahl von mehr als zehn auf, so dass § 1 KSchG Anwendung findet.
Für die Bestimmung der Betriebsgröße ist die Beschäftigtenanzahl im Restbetrieb im Zeitpunkt seiner Konstituierung im Juli 2023 maßgebend. Dies folgt daraus, dass dann, wenn ein Personalabbau auf einer einheitlichen unternehmerischen Planung beruht, für die Bestimmung der regelmäßigen Beschäftigtenanzahl im Sinne von § 23 Absatz 1 KSchG als zeitlicher Anknüpfungspunkt auf die unternehmerische Entscheidung abzustellen ist, aus der sich ergibt, wie viele Arbeitnehmer voraussichtlich insgesamt entlassen werden. Dies erfasst die Situation, dass nach einem Betriebsübergang ein Restbetrieb, der die dem Betriebsübergang widersprechenden Beschäftigten zusammenfasst, mit dem Ziel geführt wird, deren Beschäftigung in dem Betrieb zu beenden.
Im vorliegenden Fall ist daher auf den Zeitpunkt der Konstituierung des Restbetriebs abzustellen. Denn zu diesem Zeitpunkt stellte sich für den Arbeitgeber konkret die Frage, ob er diesen Restbetrieb fortführen oder abwickeln wollte. Vorliegend hat er sich für eine Abwicklung entschieden und diese Entscheidung kontinuierlich umgesetzt. Es gab nach dem Juli 2023 keinen Ansatz, den Restbetrieb mit etwa verkleinerter Belegschaft fortzuführen. Ein anderer Zeitpunkt als der Juli 2023 ist somit für die Bestimmung der regelmäßigen Beschäftigtenanzahl nicht erkennbar.
Das LAG betont zudem, dass es unerheblich sei, dass der Arbeitgeber für den Beschäftigtenabbau zunächst andere Instrumente als Kündigungen genutzt hatte. Nach der BAG-Rechtsprechung sei auf den Personalabbau als solchen abzustellen, nicht auf das hierfür gewählte Instrument.
Die betriebsbedingte Kündigung unterlag daher den Vorgaben des KSchG, war jedoch sozial ungerechtfertigt, da eine Weiterbeschäftigung in einem anderen Betrieb des Arbeitgebers möglich gewesen wäre (was der Beschäftigte mit mehr als 40 Bewerbungen auch angestrebt hatte). Der Arbeitgeber hatte unter anderem nicht überzeugend dargelegt, dass eine anderweitige Beschäftigung des Klägers im Betrieb ausgeschlossen war, oder weshalb freie Arbeitsplätze nicht für eine Umsetzung des Klägers in Betracht kamen.
© bund-verlag.de Bild: © S. Engels / Foto Dollar Club (mst)