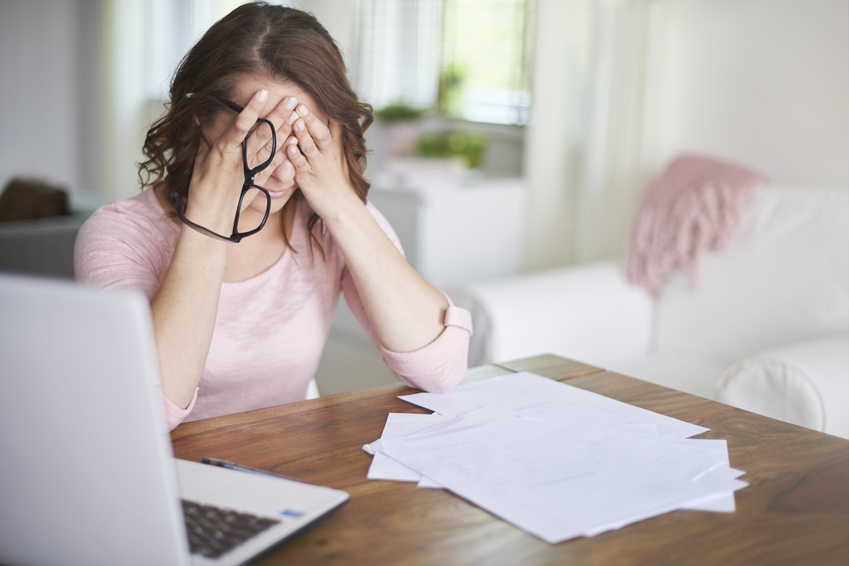Das war der Fall
Ein schwerbehinderter Arbeitnehmer wurde zum 1. Januar 2023 als Leiter der Haus- und Betriebstechnik in einem Betrieb ohne Betriebsrat eingestellt. Die Parteien vereinbarten eine sechsmonatige Probezeit. Die Arbeitgeberin wusste bei Vertragsschluss von der Schwerbehinderteneigenschaft.
Am 30. März 2023 – also innerhalb der Wartezeit nach § 1 Abs. 1 KSchG – kündigte die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis ordentlich zum 15. April 2023. Der Arbeitnehmer erhob Kündigungsschutzklage. Er machte geltend, die Kündigung sei wegen seiner Schwerbehinderung diskriminierend und deshalb nach § 7 AGG i. V. m. § 134 BGB nichtig. Außerdem hätte die Arbeitgeberin vor Ausspruch der Kündigung ein Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX durchführen müssen.
Das sagt das Gericht
Das Bundesarbeitsgericht erklärte die Kündigung des schwerbehinderten Arbeitnehmers für wirksam. Ein Anspruch auf Durchführung eines Präventionsverfahrens nach § 167 Abs. 1 SGB IX bestehe in der Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG nicht. Die Vorschrift sei, so das Gericht, systematisch an das Kündigungsschutzgesetz angebunden und finde deshalb nur Anwendung, wenn das Arbeitsverhältnis bereits unter den Schutzbereich des Kündigungsschutzgesetzes falle.
§ 167 Abs. 1 SGB IX setze „personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte Schwierigkeiten“ voraus – Begriffe, die unmittelbar aus § 1 Abs. 2 KSchG stammen. Da das Kündigungsschutzgesetz während der Wartezeit jedoch gerade keine Anwendung finde, fehle es an einer rechtlichen Grundlage für das Präventionsverfahren. Zudem sei das Verfahren keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für eine Kündigung. Es handele sich lediglich um eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – dieser greife in der Wartezeit jedoch nicht.
Auch aus der Gesetzgebungsgeschichte ergibt sich nach Auffassung des BAG nichts anderes. Trotz mehrerer Reformgesetze, wie dem Bundesteilhabegesetz 2016 und dem Teilhabestärkungsgesetz 2021, habe der Gesetzgeber bewusst darauf verzichtet, § 167 Abs. 1 SGB IX auf Kündigungen außerhalb des Kündigungsschutzgesetzes auszuweiten – obwohl das BAG bereits seit 2006 eine klare Linie vertritt. Eine entsprechende Ergänzung, wie sie etwa in § 178 Abs. 2 Satz 3 SGB IX bei unterlassener Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung erfolgt ist, habe der Gesetzgeber in Bezug auf das Präventionsverfahren nicht vorgenommen.
Zudem sah das Gericht keine Diskriminierung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Zwar könne eine Kündigung auch außerhalb des KSchG unwirksam sein, wenn sie gegen § 7 Abs. 1 AGG verstößt, etwa durch eine unmittelbare oder mittelbare Benachteiligung wegen der Behinderung. Dies sei hier jedoch nicht der Fall. Die Vorinstanzen hatten bindend festgestellt, dass die Kündigung ausschließlich auf mangelnder fachlicher Eignung beruhte. Der Kläger habe nicht darlegen können, dass diese Eignungsmängel auf seine Behinderung zurückzuführen seien oder dass behinderungsgerechte Arbeitsplätze im Betrieb vorhanden gewesen wären.
Schließlich machte das BAG deutlich, dass sich der Kläger auch nicht auf die UN-Behindertenrechtskonvention oder die Richtlinie 2000/78/EG berufen könne. Diese Normen verpflichten zwar den Gesetzgeber zur Schaffung angemessener gesetzlicher Rahmenbedingungen, begründen jedoch keine unmittelbaren Rechte gegenüber privaten Arbeitgebern. Das Präventionsverfahren selbst stelle keine „angemessene Vorkehrung“ im Sinne dieser Regelwerke dar, sondern sei lediglich ein Instrument zur Ermittlung solcher Maßnahmen.
Kernbotschaft für die Praxis
Insgesamt kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Kündigung rechtswirksam sei. Sie sei nicht willkürlich, nicht diskriminierend und auch sonst nicht rechtsmissbräuchlich erfolgt. Ein Arbeitgeber darf während der Wartezeit daher auch gegenüber einem schwerbehinderten Arbeitnehmer kündigen, ohne zuvor ein Präventionsverfahren durchzuführen – sofern keine anderweitigen Schutzvorschriften verletzt werden.
© bund-verlag.de (lr) Foto: S. Engels / Foto Dollar Club